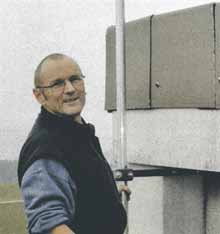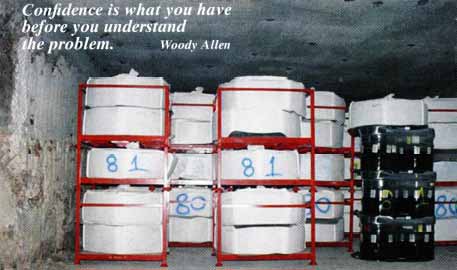Die Schweizer AKW-Betreiber haben sich jahrelang ein goldene Nase verdient.
Dennoch fehlt in den Töpfen für den Rückbau stillgelegter AKWs und für die Entsorgung
von Atommüll Geld.
Endlich hat der Bund diese beunruhigende Tatsache in einem Bericht festgehalten.

Die Schweizer AKW-Betreiber haben sich jahrelang ein goldene Nase verdient.
Dennoch fehlt in den Töpfen für den Rückbau stillgelegter AKWs und für die Entsorgung
von Atommüll Geld.
Endlich hat der Bund diese beunruhigende Tatsache in einem Bericht festgehalten.
Liebe Leserin, lieber Leser
Das Schweizer Energiejahr ist politisch bewegt zu Ende gegangen:
Der Nationalrat hat sich durch die Energiestrategie debattiert.
Aus Sicht der AKW-Gegnerschaft gibt es einen entscheidenden Schönheitsfehler:
Der «Atomausstieg» bleibt leider weiterhin nur ein Moratorium für AKWs.
Für einen Ausstieg, der diesen Namen verdient, wären klare Abschalttermine notwendig.
Aber immerhin ist der Rat den Grundsätzen der Energiewende treu geblieben.
Erneuerbare sollen gefördert, neue AKWs dürfen nicht
gebaut werden (Seite 3).

Haben Sie noch einen Funken Vertrauen in Unternehmen und Behörden,
die mit Atomkraft zu tun haben?
Dann lesen Sie unbedingt die beiden Artikel auf Seite 2.
Der eine handelt vom Tiefenlager Wipp in New Mexico (USA),
das nach der Explosion eines Atommüllfasses ausser Betrieb ist.
Der andere erzählt die Geschichte eines Versuchsreaktors in Berlin,
der wegen Rissen vorübergehend stillgelegt wurde.
In beiden Fällen ist die fehlende Transparenz besorgniserregend.

Wir berichten auch über die Arroganz von Schweizer AKW-Betreibern ( Seite 3).
Nachdem der EnergieExpress seit Jahren darauf hinweist,
dass zu wenig Geld in den Fonds für Atommüllentsorgung und AKWRückbau vorhanden ist,
hat die oberste Schweizer Finanzbehörde EFK nun genau diesen Befund offiziell bestätigt.
Die unverschämte Reaktion der Strombranche:
Die EFK beurteile die Situation völlig falsch.
Die Behörde hat ausserdem die Verstrickungen zwischen AKW-Betreibern
und den Aufsichtsbehörden kritisiert.

Mit dieser letzten Ausgabe des EnergieExpress 2014 verabschieden
wir uns bis im neuen Jahr und danken Ihnen für Ihre Treue und Unterstützung,
liebe Leserinnen und Leser.
Wie immer finden Sie auf der letzten Seite unseren praktischen Jahreskalender.
Danke, dass Sie Mitglied der GAK sind, den EnergieExpress lesen,
und damit auch die GAK und die Bemühungen für eine
atomfreie Energiezukunft unterstützen.
Ich wünsche Ihnen von Herzen alles Gute im kommenden Jahr!
Herzlich Ihre: Heidi Portmann
Unfälle in Atomkraftwerken
Die radioaktive
 Wolke
Wolke

Radioaktives Jod ist bei einem AKW-Unfall nur einer von vielen lebensbedrohlichen Stoffen.

Radioaktives Jod ist bei einem AKW-Unfall
nur einer von vielen lebensbedrohlichen Stoffen.
Die halbe Schweiz bekommt Pillen, um sich im Fall eines AKW-Unfalls gegen
strahlendes Jod zu schützen.
Doch ist Jod verhältnismässig harmlos.
Mehr als die Hälfte der Schweizer Haushalte hat Pillen bekommen,
um sich im Fall eines AKW-Unfalls gegen strahlendes Jod zu schützen.
Es entweicht jedoch nicht nur Jod, sondern viele andere gefährliche
Isotope wie Cäsium und Strontium.
Die Verteilung von Jodtabletten an Hunderttausende Haushalte hat bewusst gemacht,
wie ungeschützt die Bevölkerung bei einem AKW-Gau wäre.
Mit einer provokativen Aktion hat Greenpeace den Finger
auf diesen wunden Punkt gelegt. Die NGO hat im Namen der
Behörden einen Flyer verschickt,
in dem sie auf die vielen offenen Fragen hinweist.
Tatsächlich ist es so, dass die Tabletten so etwas
wie der Tropfen auf den heissen Stein sind.
Bei einem AKW-Unfall kann radioaktives Jod entweichen.
Es wird eingeatmet und reichert sich in der Schilddrüse und anderen Organen an.
Die hohe Strahlenbelastung erhöht das Risiko, später an Schilddrüsenkrebs
zu erkranken. Das gilt besonders für Kinder und Jugendliche.
Schluckt man rechtzeitig die Jodtabletten, schütz man die Schilddrüse wirksam,
nicht aber die anderen Organe.

Jod ist bei einem AKW-Unfall nur einer von vielen lebensbedrohlichen Stoffen.
Unter anderen entweichen auch Cäsium und Strontium.
Cäsium schädigt — wie alle anderen im Körper aufgenommenen
radioaktiven Isotopen — die DNA der Zellen.
Verstrahlte Kinder erleiden in ihrem späteren Leben bösartige
Erkrankungen, die oft tödlich enden.
Erwachsene hingegen bekommen erst nach 20 bis 25 Jahren die
 typischen Symptome. Auch sie sterben früher.
Die Strahlung aus radioaktiven Isotopen schädigt ausserdem die
Eizellen der Frau und die Spermien des Mannes.
Das kann zu Sterilität führen oder zu Missbildungen beim Nachwuchs.
Auch Fehlgeburten sind möglich.
Dazu kommen genetische Schäden, die an die Folgegenerationen weiter
gegeben werden.
Mediziner können derzeit nichts gegen radioaktives Cäsium tun.
Gewisse Mittel helfen immerhin, das im Körper gespeicherte radioaktive
Cäsium schneller zu eliminieren.
Doch gibt es weder eine Therapie noch wirksame Medikamente.
typischen Symptome. Auch sie sterben früher.
Die Strahlung aus radioaktiven Isotopen schädigt ausserdem die
Eizellen der Frau und die Spermien des Mannes.
Das kann zu Sterilität führen oder zu Missbildungen beim Nachwuchs.
Auch Fehlgeburten sind möglich.
Dazu kommen genetische Schäden, die an die Folgegenerationen weiter
gegeben werden.
Mediziner können derzeit nichts gegen radioaktives Cäsium tun.
Gewisse Mittel helfen immerhin, das im Körper gespeicherte radioaktive
Cäsium schneller zu eliminieren.
Doch gibt es weder eine Therapie noch wirksame Medikamente.

Eine weitere Gefahr ist radioaktives Strontium.
Es hat eine biologische Halbwertszeit von 17½ Jahren
und lagert sich in Knochen und Knochenmark ein.
Wie Cäsium täuscht Strontium-90 den Körper perfide:
Es wird als vermeintliches Calcium in die Knochen eingebaut.
In unmittelbarer Nähe zum blutbildenden Gewebe, dem Knochenmark,
begünstigen die radioaktiven Substanzen die Bildung von Tumoren
und erhöhen die Wahrscheinlichkeit, dass der Körper an Leukämie erkrankt.
Gegen Strontium-90 ist die Medizin machtlos.
Das Schwermetall Plutonium ist giftig wie Blei oder Quecksilber.
 Viel problematischer ist aber seine Radioaktivität.
Durch Aufnahme über Lebensmittel, besonders aber durch Einatmen kann es sich in Lunge,
Knochen und Zähnen ablagern.
Seine Halbwertszeit liegt bei 24'000 Jahren.
Die Liste liesse sich weiterführen mit vielen weiteren Substanzen,
die den menschlichen Organismus bedrohen,
wie zum Beispiel Xenon und Krypton.
Nach einem Unfall können radioaktive Isotope wie Jod, Cäsium, Strontium und Plutonium mit dem Wind
Hunderte von Kilometern weit getragen werden.
Auch heute noch sind die Folgen des Tschernobyl-Unglücks für die Umwelt bis nach Bayern
unmittelbar spürbar: Anfang Dezember 2014 mussten 37 in Augsburg geschossene
Wildschweine wegen massiv erhöhter Cäsium-Werte entsorgt werden.
Viel problematischer ist aber seine Radioaktivität.
Durch Aufnahme über Lebensmittel, besonders aber durch Einatmen kann es sich in Lunge,
Knochen und Zähnen ablagern.
Seine Halbwertszeit liegt bei 24'000 Jahren.
Die Liste liesse sich weiterführen mit vielen weiteren Substanzen,
die den menschlichen Organismus bedrohen,
wie zum Beispiel Xenon und Krypton.
Nach einem Unfall können radioaktive Isotope wie Jod, Cäsium, Strontium und Plutonium mit dem Wind
Hunderte von Kilometern weit getragen werden.
Auch heute noch sind die Folgen des Tschernobyl-Unglücks für die Umwelt bis nach Bayern
unmittelbar spürbar: Anfang Dezember 2014 mussten 37 in Augsburg geschossene
Wildschweine wegen massiv erhöhter Cäsium-Werte entsorgt werden.
* * *
Studie des Öko-Instituts Darmstadt
Wenn Fukushima in der Schweiz wäre …
Eine neue Studie zeigt, dass bei einem schweren Atomunfall
in der Schweiz die Trinkwasserversorgung an vielen Orten gefährdet wäre.
Betroffen wären vor allem Basel, Rheinfelden, Aarau,
grenznahe Städte in Deutschland und Frankreich,
möglicherweise auch Zürich.

Ein AKW-Unfall kann die Trinkwassergewinnung aus Aare und Rhein verunmöglichen.

Ein AKW-Un#173;fall kann die Trink#173;was#173;ser#173;ge#173;win#173;nung aus Aare und Rhein ver#173;un#173;mög#173;li#173;chen.
Innert kürzester Zeit könnte das Wasser der Aare und des Rheins
nicht mehr als Trinkwasser genutzt werden,
sollte sich in einem Schweizer Atomkraftwerk ein Unfall
vom «Typ Fukushima» ereignen.
Dies ist das zentrale Ergebnis einer aktuellen Studie,
die das Öko-Institut Darmstadt erstellt hat.
Auftraggeber der Studie war der
Trinationale Atomschutzverband (TRAS),
zu dessen Mitgliedern über hundert Städte und Gemeinden
in Süddeutschland, im Elsass und in
der Schweiz zählen.
TRAS wollte wissen, welche Auswirkungen ein Unfall
in einem der drei Schweizer Atomkraftwerke
Leibstadt, Beznau oder Gösgen auf die
Trinkwasserversorgung hätte.

Grundlage der Studie war die Annahme,
dass auch die Schweizer Atomkraftwerke Extremereignissen
ausgesetzt sein könnten.
Bei einem Unfall wie in Fukushima müsste Kühlwasser
ins Innere des Reaktors geleitet werden,
um eine Kernschmelze abzuwenden.
Dieses würde bei einem Leck vor allem in die Flüsse Aare und Rhein abfliessen.
Bei einem Unfall im AKW Gösgen käme radioaktiv
belastetes Wasser nach etwa einer Stunde in Aarau an.
Ebenfalls eine Stunde ginge es, bis nach einem Unfall im AKW Leibstadt
das verseuchte Wasser des Rheins die Klein-stadt Rheinfelden erreichen würde.
Bis nach Basel brauchte das Wasser rund 14 Stunden.
Das kontaminierte Kühlwasser würde jedoch nicht nur in die Flüsse,
sondern auch ins Grundwasser gelangen.
Vergleich mit Fukushima
Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler
des Öko-Instituts gingen von der Menge radioaktiver Stoffe aus,
die bei Block 2 in Fukushima freigesetzt wurden,
und rechneten diese auf Schweizer Verhältnisse um.
Der Vergleich hat sich deshalb besonders angeboten,
weil die Schweiz typenähnliche Reaktoren wie in Fukushima betreibt.
Beim Atomunfall in Japan floss stark kontaminiertes Wasser in den Pazifik.
In der Schweiz könnte bei einem solchen Unfall die
Konzentration von radioaktivem Strontium in der Aare
bis zu 58‘000 Becquerel pro Liter ansteigen,
im Rhein bei Basel auf 6600 Becquerel pro Liter.
Der in der Schweiz für das Wasser festgelegte Toleranzwert
liegt bei einem Becquerel pro Liter.

Hinzu kommt, dass die Radioaktivität auch über den
Luftweg verbreitet würde.
Selbst in grösserer Entfernung wären damit die Seen betroffen.
Der Zürichsee, so die Studie, würde durch seine Nähe zu Beznau und Leibstadt
besonders in Mitleidenschaft gezogen.
Er wird heute zu 70 Prozent für die Wasserversorgung der Stadt Zürich genutzt.
Weniger gefährdet wären der Bodensee und der Vierwaldstättersee.
Doch je nach Windrichtung hätte die Radioaktivität auch Auswirkungen
im südlichen Deutschland und in Frankreich.
Keine Notfallpläne
Bei einem Atomunfall müssten also, so die Schlussfolgerung der Studie,
innert kürzester Zeit Massnahmen zur Sicherung der
Trinkwasserversorgung getroffen werden.
Solche Szenarien sind in den heutigen Notfallplänen
aber nicht vorgesehen.
Die Schweizer Aufsichtsbehörde,
das Eidgenössische Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI),
geht davon aus, dass bei einem Atomunfall in der Schweiz
rund 1000-mal weniger Radioaktivität freigesetzt würde als in Fukushima.
In einer Stellungnahme zur Studie des Öko-Instituts
kritisiert der Verband TRAS in deutlichen Worten das ENSI.
Ebenso wie bei der Frage nach einem möglichen Erdbeben
ignoriere es die Gefahren, die durch die Kontaminierung
von Trinkwasser ausgehen.
Das ENSI habe bis jetzt nichts unternommen,
um von den AKW-Betreibern präventive Massnahmen wie
Restwasserbecken oder Filteranlagen auf dem Gelände zu verlangen.
«Bei einem Unfall vom Typ Fukushima in der Schweiz wären Millionen
Menschen durch Radioaktivität gefährdet», schreibt TRAS.
«Die Bevölkerungsdichte ist bei uns fünfmal grösser als in Ost-Japan.
Für eine Agglomeration von 1‘000‘000 Menschen bräuchte es
540 Tanklastwagen pro Tag, nur um die Notversorgung mit 15 Liter
Wasser pro Kopf sicherzustellen.»
Das Öko-Institut seinerseits weist darauf hin,
dass gerade die älteren Atomkraftwerke generell schlechter
für Extremereignisse eingerichtet seien und nicht mehr den
heutigen Anforderungen entsprächen.
Für die Schweiz ist dies besonders von Belang, denn Beznau Ⅰ
ist mit seinem Alter von 45 Jahren nicht nur der älteste Reaktor der Schweiz,
sondern auch von ganz Europa.
(Ja von der ganzen Welt; Anmerkung des Kuckucks)
* * *
Streit um die Abluftdaten vom AKW Mühleberg
Das ENSI muss Entschädigung zahlen
Seit drei Jahren schon kämpft der Strahlenschutz-Spezialist Marco Bähler
mit dem Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorat (ENSI)
darum, dass dieses die Messdaten von Radioaktivität im
Umfeld der Schweizer AKW herausgeben müsse.
Nun hat Bähler vor Bundesverwaltungsgericht recht bekommen.

Das zumindest steht fest: Marco Bähler hat die Debatte
um die Veröffentlichung von Strahlungsdaten einen
grossen Schritt vorwärts gebracht.
Der Physikassistent und Strahlenschutz-Experte
hatte bei eigenen Messungen im Umfeld des AKW Mühleberg
eine massiv erhöhte Radioaktivität festgestellt.
Um seine Ergebnisse mit den von den AKW-Betreibern
gemessenen Daten zu vergleichen,
forderte er einen Einblick in die Unterlagen
des Eidgenössischen Nuklearsicherheitsinspektorats (ENSI),
in dessen Archiven solche Daten gesammelt werden.
Das ENSI jedoch verweigerte über Jahre hinweg mit immer
neuen Gründen und Ausreden die Herausgabe von Informationen
(der EnergieExpress
berichtete darüber, s. Nr. 103, Juli 2014).

Kürzlich, Ende Mai, veröffentlichte nun das Bundesverwaltungsgericht,
an das Bähler schliesslich gelangt war, seinen Entscheid.
Es handelt sich dabei um einen sogenannten Abschreibungsentscheid,
was bedeutet, dass der Fall nicht weiter verhandelt wird
und es kein grundsätzliches Urteil gibt.
Das ENSI hatte rechtzeitig gehandelt und war einem Urteil zuvorgekommen:
Als absehbar wurde, dass es vor dem Gericht unterliegen würde,
hatte es freiwillig einen Teil der Daten auf seiner Website veröffentlicht
und die verlangten Unterlagen an Bähler übergeben.

Auch wenn nun kein Urteil vorliegt:
Auf ungewöhnliche Weise hat das Bundesverwaltungsgericht
dennoch ein Zeichen gesetzt.
Anders als es bei Abschreibungsentscheiden üblich ist,
publizierte es diesen und machte damit öffentlich klar,
dass die Bevölkerung ein Recht auf Transparenz punkto
Strahlenmesswerten hat.
Und als zweites ist das ENSI dazu verpflichtet worden,
Marco Bähler für seine Umtriebe eine Entschädigung in der Höhe
von 10‘000 Franken zu bezahlen
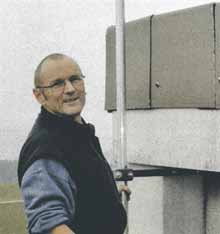
Marco Bähler beim Messen von Radioaktivität.
Die Bevölkerung hat ein Recht auf
Transparenz punkto Strahlenmesswerten
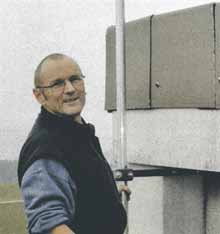

Marco Bähler beim Messen von Radioaktivität.
Die Bevölkerung hat ein Recht auf
Transparenz punkto Strahlenmesswerten
Ein Blick zurück
Was diesem Entscheid vorausgegangen war:
Im Sommer 2012 wollte der Strahlenschutz-Spezialist
Bähler herausfinden, wie viel Radioaktivität während
der damals durchgeführten Revision des AKW Mühleberg entweichen würde.
Dies aufgrund von deutschen Studien, die belegen,
dass kleine Kinder im Umfeld von Atomanlagen
überdurchschnittlich oft an Leukämie erkranken.
Die Vermutung besteht, dass in dem Moment,
in dem der Deckel des Reaktors geöffnet wird,
angesammelte radioaktive Gase in grosser Menge entweichen.
Zwar messen die AKW-Betreiber sowohl in Deutschland wie in der Schweiz
regelmassig die Strahlenwerte in der Umgebung der Anlagen,
publiziert werden aber nur die Durchschnittswerte und nie
die Spitzenwerte.

Bähler wollte es genauer wissen und stellte während
der Revision in Mühleberg an exponierten Orten
mobile Messgeräte auf.
Die Ergebnisse waren alarmierend:
In der Abluftfahne des AKW lag die Konzentration radioaktiver Stoffe
kurzzeitig um das Millionenfache höher als zu normalen Messzeiten.
Selbst im sechs Kilometer entfernten Ort Biberen-Wanneren
konnte Bähler noch 100'000 Mal höhere Werte feststellen.
Im Lauf der Revisionswoche nahmen die Werte dann schnell wieder
bis zur Unmessbarkeit ab.

Aus diesem Grund verlangte Bähler vom ENSI die offiziell
gemessenen Daten, um sie mit seinen Ergebnissen vergleichen zu können
— denn es war ihm bekannt, dass die Schweizer AKW ihre Abluftdaten
im Zehnminutentakt messen und die Werte ans ENSI übermitteln.
Mit Bählers Anfrage begann eine rund dreijährige Odyssee,
in welcher der Physiker schliesslich einige Unterlagen erhielt,
die aber aus Datenschutzgründen mehrheitlich schwarz eingefärbt
waren und für die er gesamthaft über tausend
Franken Gebühren bezahlen musste.
Marco Bähler liess nicht locker:
Mit Unterstützung von Greenpeace Schweiz ging er
vor das Bundesverwaltungsgericht,
um die Herausgabe der Daten einzuklagen.
Transparenz wäre hilfreich
Darüber, dass er nun recht bekommen hat, freut sich Bähler
— aber nur bedingt.
Denn erstens decken die ihm zugesprochenen 10'000 Franken nur einen
Teil der Unkosten, welche ihm die ganze Geschichte eingebrockt hat.
Und zweitens bedauert er, dass es nicht zu einem
verbindlichen Urteil gekommen ist.
Sein Ziel wäre es gewesen, dass alle Messdaten
der Schweizer AKW in Echtzeit
online gestellt würden und für die
ganze Bevölkerung einsichtig wären.
Denn auch nach dem Entscheid des
Bundesverwaltungsgerichts bleibt die Frage offen,
warum sich die AKWBetreiber und das ENSI dermassen davor sträuben,
ihre Messwerte zu veröffentlichen.
Schliesslich könnten sie mit mehr Transparenz
belegen, dass tatsächlich
keine Radioaktivität in die Umwelt
gelangt — eine Aussage,
auf die sie sich jedenfalls immer wieder berufen.
Christine Voss
* * *
Tschernobyl-Spätfolgen
Strahlende Wildschweine

Während in der EU Nahrungsmittel schon ab 600 Bq/kg nicht mehr zugelassen werden,
gilt in der Schweiz eine Verstrahlung erst ab 1'250 Bq/kg als gefährlich.

Während in der EU Nahrungsmittel schon ab 600 Bq/kg nicht mehr zugelassen werden,
gilt in der Schweiz eine Verstrahlung erst ab 1'250 Bq/kg als gefährlich.
Noch immer sind die Folgen der Tschernobyl-Katastrophe
in ganz Europa spürbar.
Neue Messungen zeigen:
Die Wildschweine im Bayerischen Wald sind stärker
verstrahlt als bisher angenommen.
Noch immer sind die Folgen der Tschernobyl-Katastrophe
in ganz Europa spürbar.
Neue Messungen zeigen:
Die Wildschweine im Bayerischen Wald sind stärker
verstrahlt als bisher angenommen.
Knapp drei Jahrzehnte nach dem AKW-Unfall von Tschernobyl
stellt der Bayerische Jagdverband (BJV) noch immer eine
stark erhöhte Radioaktivität bei Wildschweinen fest.
Wie aus einem Bericht hervorgeht, wurden im Jahr 2013 bei
140 geschossenen Tieren eine Belastung von mehr als
10'000 Becquerel pro Kilogramm gemessen — das ist eine
Überschreitung des zulässigen Grenzwertes (600 Bq/Kg)
 um mehr als das Sechzehnfache.
Für die Veröffentlichung dieser Daten ist Helmut
Rumml verantwortlich,
der die Messungen im Auftrag des Jagdverbandes durchführte.
Weil er seine Messungen öffentlich machte,
wurde ihm der Auftrag inzwischen entzogen.
um mehr als das Sechzehnfache.
Für die Veröffentlichung dieser Daten ist Helmut
Rumml verantwortlich,
der die Messungen im Auftrag des Jagdverbandes durchführte.
Weil er seine Messungen öffentlich machte,
wurde ihm der Auftrag inzwischen entzogen.

Der Jagdverband argumentiert, die Veröffentlichung solcher
Daten sei Behördensache.
«Wir wollen verhindern, dass der pauschale Eindruck entsteht,
alles Wildbret sei verstrahlt», teilt der BJV mit.
Wildschweinfleisch sei zwar nicht gefährlich,
sagt Peter Jacob, Direktor des Instituts für Strahlenschutz
am Münchner Helmholtz-Institut, «aber essen würde ich es nicht».
Auch das Bayerische Gesundheitsministerium mahnt zur Vorsicht:
«Eine höhere Belastung des menschlichen Körpers erhöht
grundsätzlich das Risiko einer Krebserkrankung.»

Auch in der Schweiz treten weiterhin hohe Messwerte bei Wildschweinfleisch auf.
Im letzten Jahresbericht der Abteilung Strahlenschutz des Bundesamtes
für Gesundheit (BAG)*
ist den Wildschweinen im Tessin
ein eigenes Kapitel gewidmet,
da das Tessin nach dem Unfall in Tschernobyl am stärksten von
der Cäsium-137-Kontamination betroffen war.
Dies, so hält das BAG fest, «hat aus gesundheitlicher Sicht heute
noch relevante Auswirkungen auf bestimmte empfindliche Lebensmittel».
Zu diesen gehört explizit das Wildschweinfleisch.

Im Berichtsjahr über die Jagdsaison 2013/14 wurden
von 470 im Tessin geschossenen Wildschweinen rund
30 konfisziert, da ihre Verstrahlung über dem Grenzwert lag.
Allerdings ist im Vergleich zu Deutschland festzuhalten,
dass die Schweiz den Grenzwert wesentlich höher ansetzt:
Während in der EU Nahrungsmittel schon ab 600 Bq/kg nicht mehr
zugelassen werden, gilt in der Schweiz eine Verstrahlung
erst ab 1'250 Bq/kg als gefährlich
(bei Kindernahrung ist der Grenzwert tiefer angesetzt).
Die Messungen an den Tessiner Wildschweinen zeigten Werte bis
zu 7'000 Bq/kg.
Im Unterschied zu Deutschland reagierten die Jäger positiv auf die Messungen,
hält das BAG fest.
Die Jäger «verstehen, dass die Massnahmen vor allem dem Schutz ihrer
eigenen Gesundheit dienen.
Christine Voss
* * *
| * |
Zahlen aus: Bundesamt für Gesundheit, Jahresbericht Umweltradioaktivität
und Strahlendosen in der Schweiz 2013, 8.8.2014, S. 100 ff.
Quelle: Berliner Zeitung
|
Mühleberg-Abluft
Informatik-Probleme im AWK Mühleberg
Das Informatik-System des AKW Mühleberg
hat gravierende Sicherheitslücken.
Das schreibt der «Beobachter».
Die Mühleberg-Betreiberin BKW hatte die
Reorganisation
der IT geplant und durchgeführt, die zu mehreren
Kündigungen geführt haben.
Intern für Aufruhr gesorgt hat ein IT-Mitarbeiter,
der zum Abschied in einem Rundmail geschrieben hatte:
«Ich tat mein Bestes, um die nukleare Sicherheit ernst
zu nehmen …
Ich bin nicht bereit, all diese kleinen Kompromisse
einzugehen.»
Der «Beobachter» weiss dank mehrerer
Insider von Abläufen,
die in sicherheits-relevanten IT-Bereichen
auf keinen Fall vorkommen dürfen.

Das Informatik-System des AKW Mühleberg
hat gravierende Sicherheitslücken.
Das schreibt der «Beobachter».
Die Mühleberg-Betreiberin BKW hatte die
Reorganisation
der IT geplant und durchgeführt, die zu mehreren
Kündigungen geführt haben.
Intern für Aufruhr gesorgt hat ein IT-Mitarbeiter,
der zum Abschied in einem Rundmail geschrieben hatte:
 «Ich tat mein Bestes, um die nukleare Sicherheit ernst
zu nehmen …
Ich bin nicht bereit, all diese kleinen Kompromisse
einzugehen.»
Der «Beobachter» weiss dank mehrerer
Insider von Abläufen,
die in sicherheits-relevanten IT-Bereichen
auf keinen Fall vorkommen dürfen.
«Ich tat mein Bestes, um die nukleare Sicherheit ernst
zu nehmen …
Ich bin nicht bereit, all diese kleinen Kompromisse
einzugehen.»
Der «Beobachter» weiss dank mehrerer
Insider von Abläufen,
die in sicherheits-relevanten IT-Bereichen
auf keinen Fall vorkommen dürfen.
• Das Computersystem für die technischen Anlagen
war zu den übrigen Systemen der BKW durchlässig.
• Der zitierte Mitarbeiter schrieb,
es hätten 72 Personen,
interne und externe, auf das
sicherheitsrelevante
Computersystem des AKW Mühleberg Zugang gehabt
statt nur ein paar wenige.
• Die Adressen der Computer (IP-Adressen),
sind in E-Mails verschickt worden,
ein No−go für geschützte Computersysteme.
Die BKW bestreitet die Vorwürfe,
ebenso weist die Aufsicht ENSI die
Verantwortung von sich.
Beobachter
* * *
 Die radioaktive Wolke
Die radioaktive Wolke
 Wenn Fukushima in der Schweiz wäre …
Wenn Fukushima in der Schweiz wäre …
 Das ENSI muss Entschädigung zahlen (Drohung der AKW-Betreiber)
Das ENSI muss Entschädigung zahlen (Drohung der AKW-Betreiber)
 Explosion im US-Tiefenlager Wipp /
Risse im Versuchsreaktor vertuscht
Explosion im US-Tiefenlager Wipp /
Risse im Versuchsreaktor vertuscht
 ENSI: Erdbebenstudie seit Jahren nicht erledigt
ENSI: Erdbebenstudie seit Jahren nicht erledigt
 AKW Mühleberg: Beobachter erstreitet Bericht
AKW Mühleberg: Beobachter erstreitet Bericht
 Strahlende Wildschweine
Strahlende Wildschweine
 Informatik-Probleme im AKW Mühleberg
Informatik-Probleme im AKW Mühleberg