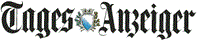 |
|
Analyse — Dass die Finma ihren kritischen Bericht über die Credit Suisse veröffentlicht hat, grenzt an ein Wunder. Normalerweise scheut die Behörde das Licht. Und setzt sich damit dem Vorwurf falscher Rücksichtnahmen aus. Von Bruno Schletti
Die Finanzaufsicht liebt die Dunkelheit

Ein bisschen Licht ins Dunkel: Der Sitz der Finanzmarktaufsicht an der Einsteinstrasse in Bern.
Foto: Martin Rütschi (Keystone)
Da erfährt die schweizerische Öffentlichkeit, dass die Credit Suisse jahrzehntelang unrechtmässig und wissentlich Tausenden US-Bürgern geholfen hat, Gelder am Fiskus vorbei ausser Landes zu bringen. Sie erfährt es in allen Details in der Nacht von Montag auf Dienstag — den US-Behörden sei Dank.
An ebendiesem Dienstag stellt auch die schweizerische Finanzmarktaufsichtsbehörde (Finma) einen Bericht über das grenzüberschreitende Geschäft der Credit Suisse mit US-Kunden ins Netz. Er geht zurück auf eine Untersuchung, die am 21. September 2012 abgeschlossen wurde. Mehr als anderthalb Jahre lang lag der Bericht mit seinen vernichtenden Befunden in der Dunkelkammer der Finma. Niemand wusste davon. Und siehe da: Am Tag, als die US-Behörden ihre Erkenntnisse publik machten, kam auch der Finma-Bericht plötzlich ans Licht. Motto: «Ätsch! Was die Amis da veröffentlichen, haben wir schon lange gewusst.»
Leider, muss man festhalten, hat das Dunkelkammer-Prinzip bei der Finma System. Niemand erfuhr, dass die Behörde Mitte Januar 2011 die Risiken der Credit Suisse im US-Geschäft zu untersuchen begann. Niemand wusste, dass die ersten Erkenntnisse so alarmierend waren, dass die Untersuchung im November 2011 in ein Enforcementverfahren mündete — eine vertiefte Abklärung, um festzustellen, ob die Bank das Aufsichtsrecht verletzt. Niemand wurde darüber informiert, dass das Verfahren im September 2012 mit einer Verfügung abgeschlossen wurde. Und schon gar nichts erfuhr die Öffentlichkeit über die erteilte Rüge wegen schwerer Pflichtverletzungen.
Zig Berichte unter Verschluss
Das ist der Normalfall. Die Finma hat in der gleichen Angelegenheit gegen mehr als zwanzig weitere Banken ebenfalls ermittelt. Gegen welche verrät sie nicht. Gegen einige dieser Banken wurden ebenfalls Verfügungen erlassen. Gegen welche bleibt unter dem Deckel. Weshalb die Finma geheimniskrämert, ist nicht wirklich herauszufinden. Spricht man Vertreter der Behörde darauf an, verirren sie sich in nebulöse Begründungen. Es ist dann etwa die Rede davon, Transparenz sei nicht im Interesse des Finanzplatzes. In den Schönwettertexten auf der Website der Finma lässt sich anderes lesen. Etwa: «Die Finma strebt möglichst viel Transparenz für alle Marktteilnehmer an.»
Tatsächlich gilt in den Finanzmärkten die transparente Gleichbehandlung aller Teilnehmer als ehernes Prinzip. Ein Prinzip, das die Finma mit ihrem Vorgehen verletzt. Während die Banker um ihre krummen Touren und die Ermittlungen der Aufsicht wissen, lässt die Finma Bankkunden und Aktionäre im Dunkeln. Gleichzeitig gibt die Behörde aber vor, sich «für den Schutz der Gläubiger, Anleger und Versicherten» einzusetzen. Manch ein Bankkunde hätte sein Depot längst geräumt, wenn er gewusst hätte, dass die Credit Suisse nicht Gewähr für eine einwandfreie Geschäftstätigkeit bietet. Manch ein Aktionär hätte seine Titel verkauft in Kenntnis davon, dass die Bank, deren Kapitalgeber er ist, Aufsichtsrecht verletzt.
Wer ist interessiert an Geheimniskrämerei? Die Antwort liegt nahe: Die von Ermittlungen betroffenen Banken.
Wer ist interessiert an der Geheimniskrämerei? Die Antwort liegt nahe: die von Ermittlungen betroffenen Banken. Es ist nicht imagefördernd, wenn die Öffentlichkeit erfährt, dass eine Bank wegen schwerer Verletzungen des Aufsichtsrechts von der Finma gerügt wird. Nicht alle Kunden und Aktionäre fühlen sich bei einer Bank zu Hause, von der sie erfahren, dass sie gegen ausländisches Recht verstösst. Einzig betroffene Banken haben ein Interesse an Heimlichtuerei. Mit ihrer Politik spielt die Finma ihr Spiel mit und macht sich zur Handlangerin ausgerechnet jener, die etwas zu verbergen haben.
Die Finma vermag auch nicht überzeugend zu erklären, weshalb sie den Enforcement-Bericht über die Credit Suisse — und nur diesen — jetzt veröffentlicht hat. Weil die Informationen über das Geschäftsgebaren der CS im Ausland — sprich in den USA — ohnehin publik geworden seien, ist eine Erklärung. Wie auch immer: Der Fall zeigt, dass kein Paragraf die Behörde an einer Publikation hindert. Es liegt in ihrem Ermessen, ihre eigenen Grundsätze, für Transparenz zu sorgen, umzusetzen.
Vermutlich gibt es einen weiteren Grund, warum sich die Finma nicht gern in die Karten schauen lässt. Sobald sie dies tun würde, müsste sie sich der öffentlichen Kritik stellen. Dass sie im Bericht die Credit Suisse schwerer Pflichtverletzungen beschuldigt, das oberste Management und den Verwaltungsrat aber reinwäscht, ist nicht nachvollziehbar und steht juristisch auf höchst wackeligen Füssen. Das riecht nach Rücksichtnahmen. Es werden Personen oder einzelne Institute geschützt. Oder man will dem Finanzplatz unangenehme Wahrheiten ersparen. Nichts von alledem ist im Interesse von Gläubigern und Anlegern, deren Schutz sich die Finma auf die Fahne schreibt.
* * *
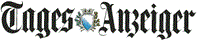 |
|
Die US-Schnüffler bei der Credit Suisse
Von Simon Schmid und Walter NiederbergerDer Finanzregulator von New York installiert einen Monitor bei der Credit Suisse. Findet er neues Material, könnte es für die Führung noch einmal brenzlig werden.
Die amerikanischen Behörden installieren einen Aufpasser für die Credit Suisse. Dieser Monitor wird die Bank erneut durchleuchten und gegebenenfalls weitere Massnahmen anordnen. So steht es in der Vereinbarung zwischen der Credit Suisse und dem Departement of Financial Services (DFS) in New York. Allerdings ist dem Überwacher ein Zugriff auf die Daten der US-Kunden verwehrt, die sich strafbar machten, wie ein US-Anwalt mit Mandaten von Schweizer Banken und Bankern sagt.
Der Monitor muss von der Bank bezahlt werden. Ernannt wird er von DFS-Chef Benjamin Lawsky, der eine satte Busse von 715 Millionen Dollar aushandeln konnte. Diese Mittel fliessen in die Kasse des Staates New York. Lawsky will einen «aggressiven und fairen Monitor» einsetzen, der direkt an die Behörde rapportiert. Ob die Wahl der Überwachungsfirma schon erfolgt ist, konnte der DFS-Mediensprecher gestern nicht klären. Doch sollte die Bank ein Vetorecht gegen die Wahl haben, sagen Anwälte, die den Fall UBS untersucht hatten. Der Monitor dürfte am Hauptsitz in Zürich tätig sein und nach Bedarf auch ausländische Filialen besuchen.
Auftrag ist, die Compliance-Vorschriften und -Prozeduren zu durchleuchten, die zum Zeitpunkt der Gesetzesbrüche galten. Gefordert ist ein Bericht über die Beteiligung von einzelnen Angestellten an der Beihilfe zur Steuerhinterziehung und anderen Delikten — «inklusive aber nicht beschränkt auf aktuelle und ehemalige leitende Angestellte, Direktoren und andere Angestellte», wie es im Bericht heisst. Rapportieren soll der Überwacher ferner, ob die Bank ihre Strukturen genügend rasch und effektiv angepasst hat und welche weiteren Reformen nötig sind, um künftiges Fehlverhalten zu unterbinden.
Misstrauensvotum an die Finma
Die Prüfgesellschaft kann somit die gesamte Vergangenheit noch einmal aufrollen. Wirtschaftsanwälten zufolge können auch alte Verwaltungsratsprotokolle gelesen und der Mail-Verkehr durchleuchtet werden. Taucht belastendes Material auf, so seien Klagen oder regulatorische Massnahmen gegen Einzelpersonen bis in die Bankspitze möglich. Nach einem halben Jahr ist ein Zwischenbericht fällig, nach zwei Jahren ein Schlussbericht.
Die Anordnung kann auch als Misstrauensvotum an die Finma aufgefasst werden. Finma-Sprecher Tobias Lux betont jedoch, es handle sich beim Einsatz eines Monitors «um eine Standardmassnahme, auf die von den US-Behörden regelmässig zurückgegriffen» werde. Die Finma hat sich gemäss ihrem gestrigen Bericht von einem unabhängigen Prüfer bestätigen lassen, dass die CS nicht steuerkonforme Kunden entweder regularisiert oder verabschiedet und zudem ein angemessenes Risikomanagement eingeführt hat.
Was ein externer Aufpasser bedeuten kann, zeigte sich bei der UBS. Die Bank musste 2008 auf eigene Kosten eine unabhängige Untersuchung über ihren Ausstieg aus dem Geschäft mit US-Offshore-Kunden dulden. Im Auftrag einer US-Anwaltskanzlei flogen über ein Dutzend KPMG-Leute von der Schweiz bis nach Australien und auf die Cayman Islands, um Akten zu durchforsten. Nach achtzehn Monaten vermochte die Bank die US-Justiz zu überzeugen, dass man alle problematischen US-Bürger losgeworden war.
Verweis auf die Schweiz fehlt
Eine Passage aus dem Vergleich der UBS lässt aufhorchen. «Die Regierung anerkennt, dass der Audit-Prozess und sämtliche Berichte mit den Schweizer Gesetzen konform sein müssen», heisst es. Im Dokument der CS hingegen ist nur von «geltendem Recht» die Rede. Es fehlt also der explizite Verweis auf die Schweiz. Die CS müsse den Zugriff auf «alles relevante Personal, Dokumente, Berichte oder Beweise» erlauben, sei dies in New York oder in der Schweiz.
* * *
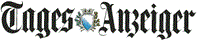 |
|
«Obama will das Boot ruhig halten, in dem er mit den Bankern sitzt»
Die Ex-Bankerin Nomi Prins kritisiert die enge Verbundenheit des Weissen Hauses mit den US-Finanzinstituten.
Mit Nomi Prins sprach Walter Niederberger in BerkeleySie haben die engen Beziehungen zwischen den etablierten Banken der USA und Präsidenten der Supermacht in den letzten hundert Jahren analysiert. Geben Sie uns ein Beispiel dafür.
Die Friedensverhandlungen von Versailles nach dem Ersten Weltkrieg zeigen anschaulich, wie eng die Interessen des US-Präsidenten mit jenen der Wallstreet-Banken verbunden sind. Präsident Woodrow Wilson brachte unter anderem Thomas Lamont mit, einen Partner der mächtigen Morgan Bank. Nachdem Wilson zurück in die USA gereist war, verhandelte Lamont in Europa im Einverständnis mit dem Präsidenten über die Reparationszahlungen von Deutschland. Wilson räumte später zwar ein, sein Bündnis mit der Wallstreet könnte vom Volk missverstanden werden. Doch habe er Lamont bewusst einen Teil seiner Politik abgetreten, um die Banken zu Partnern des Weissen Hauses zu machen.

Man kennt sich, man versteht sich: Präsident Barack Obama begrüsst Jamie Dimon, Chef von J.P. Morgan.
Foto: Jason Reed (Reuters)
Banker Lamont übernahm effektiv präsidiale Aufgaben?
Genau. Europäische Länder waren bei den deutschen Reparationsverhandlungen mit ihren Zentralbankern vertreten, die USA aber mit einem Wallstreet-Banker. Dieses sehr amerikanische Verständnis von Weltpolitik hat sich bis heute gehalten.
Auch die Credit Suisse, obgleich keine US-Bank, ist an der Wallstreet tätig. Wie erklären Sie die hohe Busse und das erzwungene Schuldgeständnis für die Beihilfe zur Steuerflucht?
Ganz klar hat sie einen Wettbewerbsnachteil gegenüber den etablierten Banken, die tiefere Wurzeln in der Regierung haben. Die Führungsetage der Credit Suisse konnte ganz einfach nie die gleich starken politisch-finanziellen Bande entwickeln wie J.P. Morgan und die anderen Big Players. Es war Morgan, und nicht die Credit Suisse, die das US-Finanzministerium vor hundert Jahren aus der grossen Finanzkrise gerettet hat. Auch waren es die US-Finanzhäuser, nicht die Credit Suisse, die alle grossen Kriege finanzieren halfen und Filialen in Ländern eröffnet haben, in denen die USA ihre militärische Präsenz ausbauen wollten. Kein Banker der Credit Suisse ist jemals als Klasse-A-Direktor im Verwaltungsrat der New Yorker Notenbank gesessen, wie Jamie Dimon (Chef der J.P. Morgan, d. Red.) und andere Wallstreet-Banker dies taten.
Wie gelingt es Wallstreet-Banken, für ihre Missetaten immer wieder spezielle, relativ milde Rechtsverfahren zu erhalten und Schuldgeständnisse zu umgehen?
Die US-Banken und die Regierung wirken in einem sich gegenseitig verstärkenden Machtverhältnis. Ein aktuelles Beispiel: Ex-Finanzminister Timothy Geithner befindet sich derzeit auf Tournee, um seine Memoiren «Stress Test» vorzustellen. Dass er dabei unverblümt behaupten kann, in der Finanzkrise das einzig Mögliche zur Rettung des Finanzsystems getan zu haben und dass die Medien ihn in dieser Heldenrolle zeigen, macht deutlich, wie gut die Elite-Banker auch medial abgesichert sind. Geithner hat nicht die Banken gerettet, wie er behauptet, sondern er hat sie grösser und damit riskanter gemacht.
Dennoch insistiert er darauf, er habe sich nie von den Banken der Wallstreet vereinnahmen lassen.
Ist es nicht interessant, dass er seit dem Abgang als Finanzminister für Warburg Pincus arbeitet — eine kleine Elitebank, die auf Paul Warburg zurückgeht? Warburg war einer der Gründer der Federal Reserve. Und Geithner war Chef der New Yorker Filiale der Notenbank und direkter Handelspartner von der Wallstreet, bevor Präsident Obama ihn einstellte. Was ich damit sagen will: Jene, die das Geld kontrollieren, sei es bei den Banken oder in der Regierung, sind in den USA oft auf Jahrzehnte zurück gegenseitig verbunden und bleiben sich entsprechend verpflichtet.
«Für den Bruch zwischen dem US-Präsidenten und den Banken bräuchte es wohl eine weitere, grössere Krise.»
Glauben Sie, dass es für das Justizministerium auch aus diesem Grund einfacher war, einer Auslandbank wie der Credit Suisse ein Schuldgeständnis abzuringen?
Justizminister Eric Holder wurde stark kritisiert, weil er nach der Finanzkrise nicht härter gegen die «Big Six» J.P. Morgan, Bank of America, Citigroup, Morgan Stanley, Goldman Sachs und Wells Fargo vorgegangen ist. Doch Holder würde mit einem Strafverfahren oder einem Schuldgeständnis einer US-Bank die eigene Regierung und die Wallstreet gegen sich aufbringen. Deshalb hat sich keine einzige US-Bank wegen der Subprime- und der Kreditkrise schuldig bekennen müssen.
Was bedeutet das Geständnis der Credit Suisse im amerikanischen Selbstverständnis?
Die amerikanischen Medien rücken heute das Verfahren gegen die Credit Suisse so ins Bild, als ob Holder tatsächlich gegen die eigenen «Too Big to Fail»-Banken vorgegangen wäre. Dies ist nicht der Fall, doch seine PR-Kampagne scheint gut aufzugehen.
Aber Präsident Barack Obama hat die «Fat Cat»-Bankers an der Wallstreet kritisiert und Rechenschaft gefordert.
Das Gleiche hat schon Woodrow Wilson getan, als er den berüchtigten «Money Trust» an Wallstreet angeprangert hat. Dies hat ihn nicht daran gehindert, mit ebendiesen Bankern segeln zu gehen. Obama geht mit ihnen Golf spielen. Auch bei ihm gibt es einen Unterschied zwischen dem, was er sagt, und dem, was er tut. Niemand wird behaupten können, dass er eine wirkliche Re-Regulierung der Wallstreet durchgesetzt hat. Präsident Obama will das Boot ruhig halten, in dem er mit den Bankern sitzt.

Sie haben gesagt, dass sich kein Banker wegen der Missbräuche im Hypothekar- und Derivatgeschäft strafrechtlich verantworten musste. Ist dieser Mangel an rechtlicher Verantwortung neu?
Nein. Die Wallstreet wurde rechtlich immer anders behandelt als andere Branchen. Die letzte und praktisch einzige Ausnahme eines Topbankers, der strafrechtlich belangt wurde, liegt 80 Jahre zurück. Charles Mitchell war Chef der National City Bank, damals eine der Big-Six-Banken. 1933 musste er vor dem Kongress wegen der Finanzmanipulationen aussagen, die zum grossen Börsencrash geführt hatten. Mitchell war kein Mann der Reue und Einsicht. Doch die Anhörungen machte das Ausmass an Gier so deutlich, dass sich die Öffentlichkeit angewidert abwandte. Mitchell wurde schliesslich wegen Steuerbetrug angeklagt und musste gehen.
Nehmen wir die Präsidenten Nixon oder Carter. Haben sie sich nicht gegen Interventionen der Banken in ihre Aussen- oder Finanzpolitik gewehrt?
Nur in einem geringen Ausmass. In der Regel akzeptierten die Präsidenten nicht nur die Hilfe und den Einfluss der Wallstreet-Banken. Sie forderten die Banken sogar dazu auf. Beispiel Zweiter Weltkrieg. Präsident Roosevelt bittet die Wallstreet, ihm beim Verkauf der Kriegsanleihen ans Volk zu helfen. Die Banken sagen gerne zu, und zwar nicht allein aus patriotischer Pflicht. Sie können so direkt wertvolle Beziehungen zu Mittelstandsfamilien aufbauen, die ihnen zuvor kritisch gesinnt waren. Diese bildeten dann nach dem Krieg die Basis für den Wirtschaftsaufschwung. Überhaupt brachten die Kriege die Präsidenten und die Banken immer wieder näher zusammen. Wollten die USA eine Weltmacht werden und bleiben, so musste das Land allen anderen auch finanziell überlegen sein. Dieses Ziel einte beide Seiten.
Barack Obama kam als Aussenseiter an die Macht. Warum haben die Wallstreet-Banken ihn schon 2008 unterstützt?
Obama ist ein gutes Beispiel dafür, dass es aus Sicht von der Wallstreet nicht darauf ankommt, wer Präsident ist, wenn die alten Seilschaften bestehen bleiben. Leute wie Robert Rubin — Ex-Top-Banker und Finanzminister unter Bill Clinton — sorgten dafür, dass Obama für seine Finanzposten fast durchwegs wieder die gleichen Leute einstellte, die bereits für den an der Wallstreet sehr beliebten Bill Clinton gearbeitet hatten. Larry Summers wurde Wirtschaftsberater. Dass Obama ihn auch zum Notenbankchef machen wollte, zeigt nur, wie stark diese Seilschaft war. Timothy Geithner wurde Finanzminister, weil er zuvor schon bei der Notenbank mit Robert Rubin zusammengearbeitet hatte, der wiederum zusammen mit Summers die Deregulierung der Banken unter Clinton forciert hatte. Auch der jetzige Finanzminister Jack Lew war schon für Clinton tätig, ebenso Notenbankchefin Janet Yellen.
Sie schliessen Ihr neues Buch mit der Aussage ab, dass diese Allianz gebrochen werden müsse, bevor sie uns breche. Was meinen Sie damit?
Es wird nicht ohne weiteres zum Bruch zwischen den US-Präsidenten und den Bankern kommen. Dafür bräuchte es wohl eine weitere, grössere Krise. Ähnlich wie in den 30er-Jahren müsste es dafür eine extreme wirtschaftliche Depression geben, die eine Mehrheit der Bevölkerung erfasst und durchschüttelt. Was es aber vor allem braucht, sind echte Führungsfiguren, Ausnahmetalente wie Winthrop Aldrich, den Präsidenten der Chase Bank in der Depression. Seine soziale Verantwortung sagte ihm, dass riskantes Investmentbanking vom traditionellen Leih- und Spargeschäft zu trennen ist. Er setzte sich gegen die eigene Branche durch und unterstützte die Bankenreform, die sich 60 Jahre lang bewährt hat.
Wagen Sie eine Prognose, wann die nächste grosse Krise an der Wallstreet kommt?
Viele sagen, die Krise stehe unmittelbar bevor. Ich rechne damit in etwa drei Jahren, und zwar deshalb, weil die Tiefzinspolitik der Notenbank die Risse in den Banken vorübergehend zugedeckt hat. Doch der Bruch zwischen den mit billigem Geld gepolsterten Banken und der Realwirtschaft ist so gross, dass es krachen muss.
* * *


