➔ Bedenken
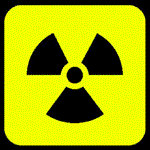
Die Atom-Lobby macht gutes Geld mit sogenannt "billigem" Strom.
Das möchte sie weiter tun, möglichst lange.
 Dazu hat man schliesslich viel aufgewendet
— und dennoch gut verdient.
Man hat zum Beispiel bewusst und mit viel Geld die
Entwicklung der erneuerbaren Energien behindert
und ein 10-jähriges Moratorium überstanden.
Darum hat die Schweiz — einmal führend bezüglich
erneuerbare Energien —
jegliche Weiterentwicklung verschlafen.
Dazu hat man schliesslich viel aufgewendet
— und dennoch gut verdient.
Man hat zum Beispiel bewusst und mit viel Geld die
Entwicklung der erneuerbaren Energien behindert
und ein 10-jähriges Moratorium überstanden.
Darum hat die Schweiz — einmal führend bezüglich
erneuerbare Energien —
jegliche Weiterentwicklung verschlafen.
Um weiterhin möglichst wenig zu ändern und weiter gut kassieren zu können, hat man jetzt die Strom-Lücke erfunden, die man der Industrie für teures Geld verkauft.
Es passt der Atom-Lobby sehr gut in den Kram, dass ein weiterer Ausbau des Strom-Netzes bevorsteht. Und er kostet Geld. Wenn wir aber in Zukunft auf erneuerbare Energien setzen, muss der Ausbau anders erfolgen, als wenn er für zentralisierte Grossanlagen wie AKWs erfolgen soll. So kann man die Kosten der Wende anlasten, den Ausbau aber schnell so vorantreiben, dass er nur für die Grossanlagen passt. Damit könnte man die Wende weiter verzögern und verteuern — und inzwischen nochmals absahnen.
Jeder Entscheid, AKWs nicht abzustellen, respektive Laufzeiten zu verlängern, vermindert bei dieser Politik automatisch die Investitionen in die erneuerbaren Energien, verteuert den Umstieg und bringt die Schweiz bezüglich vernünftiger Energie und vernünftigem (effizientem) Einsatz der Energie weiter ins Hintertreffen. Das unterstützt die Atom-Lobby bei der angedrohten Strom-Lücke.
Weltweit ist das Problem der radioaktiven Abfälle in keinster Art gelöst. Und keiner der Atom-Barone will sie bei sich im Keller hunderttausend Jahre lagern. — Irgend wann muss aber das Problem gelöst werden. Der Bau der entsprechenden unterirdischen Kavernen wird Unsummen an Geld verschlingen. Dazu kommen noch empfindliche Auslagen für die Wartung dieser Kavernen über Jahrtausende; wenn man das nicht macht, ist der nächste atomare Gau bereits programmiert. Dieses Geld müsste auch durch den Preis des Atom-Stroms bereitgestellt werden. Wird es aber nicht!
Bereits stillgelegte AKWs zeigen, dass mit der Stilllegung auch hier die Kosten nicht aufhören. Die Brennstäbe müssen noch jahrelang gekühlt werden. Die Anlagen ebenso, und danach müssen sie überwacht und später versiegelt werden. Auch sie sind noch Jahrzente "unbetretbar". Das bis jetzt dafür auf die Seite gelegte Geld dürfte wahrscheinlich nicht einmal für die Stilllegung eines einzigen unserer AKWs reichen.

Eines ist klar: die Strom-Kosten müssen steigen, mit oder ohne AKWs. Aber die Preise für Alternativ-Energien werden noch gehörig sinken, während die Preise für Atom-Strom noch dramatisch steigen müssten, um ihre Kosten zu decken.
Da hat es wohl die Elektrizitätswirtschaft eher mit dem Prinzip der UBS:
Kommt Zeit, kommt Geld !
Notfalls vom Steuerzahler !
Nicht zu vergessen gehören zur wirtschaftlichen Entwicklung nicht nur Kosten sondern auch die Zahl der verfügbaren Arbeitsplätze. Während die Atom-Lobby mit den steigenden Preisen, für die sie eigentlich selber verantwortlich ist, und dem Schreckgespenst «Strom-Lücke», die sie mit ihrer Verhinderungstaktik selber heraufbeschwört, mit Problemen für die Wirtschaft droht, wird ein klarer Entscheid zur Wende einerseits langfristig weniger Mehrkosten und kurz- und mittelfristig hunderte von neuen Arbeitsplätzen bringen.
Diese Angaben stammen von Juni 2011. Im Sommer 2014 erst schaltet sich die Eidgenössische Finanzkontrolle ein:
Artikel des Zürcher Unterländer©s (www.zumkuckucksei.net/Politik/krisen/ZU-AWK-20141127.html#ART2) vom 27. Nov 2014.
Auch die Stromversorger haben aus der Erfahrung mit ihren Projekten berechtigte Bedenken. Seit Jahrzehnten gibt es kein einziges grösseres Kraftwerkprojekt, das nicht durch massive Einsprachen wenn nicht verhindert, so doch massiv verzögert wurde.
Zum Teil sind diese Einsprachen durchaus gerechtfertigt und führen zu umweltverträglicheren Lösungen oder zeigen auch mal Gesetzesverstösse der Behörden auf. Ein anderer Teil dieser Einsprachen ist aber absolut übertrieben und führt zu unnötigen Mehrkosten, die wir wieder alle als Stromkonsumenten berappen.
Die Stromerzeugung durch viele kleine Lieferanten wird einen gewissen Verwaltungs- und Management-Aufwand bringen, das ist nicht zu leugnen. Es ist aber so oder so und in jedem Falle die wichtigste Art der Stromerzeugung der Zukunft und daher nicht zu verhindern.
Sie befürchten eine absolute Verschandelung der Ortsbilder und Landschaften. Diese zu schützen ist ein hehres Ziel. Aber man kann nicht alles so behalten, wie es ist. Wir wollen auch nicht das ganze Land zu einem einzigen bewohnten Museum degradieren. Ebenso wenig wollen wir immer wieder neues Land zersiedeln, um gemäss heutigen Bedürfnissen wohnen und arbeiten zu können.
In diesem Sinne muss wohl erwogen werden, was es zu bewahren gilt, und was dem Lebendigen weichen muss. Allzu oft gibt es für beides gute Gründe. Dennoch wäre eine Mässigung entsprechender Einsprachen durchaus wünschenswert.
Es ist nicht jede nach Süden schauende Betonwand vor Photovoltaïk-Elementen zu schützen. Die meisten davon wären ja ohnehin schöner, wenn sie mit Pflanzen oder Graffiti bedeckt wären. Auch sicher 99% der geeigneten Hausdächer können problemlos für die Stromerzeugung genutzt werden. Es gibt nur wenige, wirklich historische Dächer, die diesbezüglich geschützt werden müssen. Hier wäre grosszügigere Bewilligungspraxis angesagt. Es gibt gar manches Dach, das mit entsprechenden Elementen der Stromversorgung sogar besser aussähe.
Auch die Begründung der Bewilligungsverweigerung mit dem Blend-Effekt ist etwas fadenscheinig. Jedes heutige Auto mit seinen schrägen und gewölbten Scheiben, aber auch mit seiner Hochglanzpolitur blendet in jeder Stellung und bei jedem Sonnenstand enorm. Bei fixen geraden Flächen ist der Blendwinkel dagegen sehr klein.
Auch bei jedem Windrad wird prinzipiell mal opponiert. Dagegen ist zu sagen, dass Hügelketten, die Bäume oder Windräder tragen, kein schlechteres Bild abgeben als nackte Hügel. Ein anderes Problem kann der beim Betrieb entstehende Lärm darstellen, sei es im Bereich von Siedlungen, sei es im Bereich von Rückzugsgebieten für Tiere, oder auch menschlichen Erholungsgebieten. Allerdings ist auch zu beachten, das starke Winde sowieso mit Geräusch verbunden sind.
Auch Wasserkraftwerke sind nicht zum Vornherein schlecht. Gerade Pumpspeicherwerke werden im Zusammenhang mit erneuerbaren Energien gefragt sein. Es ist auch klar, dass sowohl Flusskraftwerke wie Stauseen gewisse Auflagen zu erfüllen haben. Auch Kleinkraftwerke dürften in Zukunft wieder willkommenere Lieferanten sein, weil ohnehin die ganze Strom-Verteilung auf viele kleine Lieferanten ausgelegt werden muss.
Eines hat «Fukushima» gezeigt. Kern-Energie ist und bleibt gefährlich, und zwar nicht nur im Moment eines unerwarteten Ereignisses, sondern über Jahrhunderte, unsichtbar, lebensgefährlich. Und Sicherheit kann niemand garantieren, auch hochtechnisierte Staaten nicht. Auch überhebliche Techniker, die meinen die Natur im Griff zu haben, können das nicht.
Und den Beteuerungen der Grosskonzerne kann man nie trauen. Auch wenn sie nach bestem Wissen und Gewissen handeln, sie können immer wieder in ausserordentliche Situationen geraten, in denen sie nicht mehr handeln können. Dazu kommt, dass es in diesen Unternehmen immer wieder Leute geben wird, die der Versuchung erliegen, zu Lasten der Sicherheit zu sparen. Menschliches Versagen ist sowieso nie ganz auszuschliessen. Nicht einmal Computer-Pannen können wir garantiert ausschliessen.
Was geschieht, wenn die Tiefenlager mal bestehen und die «NAGRA» macht Konkurs? So einfach ist das.
Nach Fukushima entscheidet sich die Schweiz für eine Energiewende, das heisst unter anderem Atomausstieg. 2014 beginnt das Parlament diesen Entscheid in Salami-Taktik wieder aufzulösen, weil sich mit zu billigem Atmostrom hat doch viel Geld machen lässt; und die Wende hiesse ja auch «Energie sparen»:
Artikel des Zürcher Unterländer©s (www.zumkuckucksei.net/Politik/krisen/ZU-AWK-20141127.html) vom 27. Nov 2014.